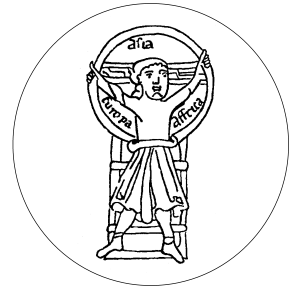Diese Konferenz findet vom 20.06.2012-22.06.2012 in Wolfenbüttel statt.
Das Arbeitsgespräch basiert auf der Prämisse, dass Bücher konzipiert wurden, um von einer Hand in eine andere zu wechseln. Bibliotheken wie die Herzog August Bibliothek sehen eine Hauptaufgabe darin, die Weitergabe von Codices für einen möglichst langen Zeitraum zu gewährleisten. Das Buch fungiert als Bindeglied zwischen Produzenten und Konsumenten, zwischen Donatoren und Rezipienten, und es kettet und kittet mehrere Generationen aneinander. Das Buch verbindet Schreiber mit Lesern, Schreiber mit Schreibern und Leser mit Lesern. Die Tagung knüpft an Forschungen über Darstellungen von Gegenständen (unter ihnen Büchern) an, die während des Mittelalters und der frühen Neuzeit als Gaben genutzt wurden, um das Seelenheil zu erlangen und die Memoria zu sichern.
Bücher sind dazu da, um von Hand zu Hand weitergereicht zu werden. Leser und Schreiber agieren dabei in einer buchstäblich handelnden Gemeinschaft. Viele Hände hinterlassen Spuren, und diese wurden und werden von späteren Lesern entdeckt und von den nachfolgenden Forschern als Quelle genutzt – z.B. Selbstkarikaturen von Korrektoren, Selbstdarstellungen von Figuren ohne Namens- oder Funktionsangabe, in Wortspiele eingebundene Selbstportraits von Illuminatoren, Schlussbemerkungen der Schreiber, die Gebete fordern oder mit Flüchen drohen, Darstellungen von Stiftern als kniende Donatoren, aber auch Listen mit den Namen von Benutzern, die in die Handschriften eingelegt sind. Diese Spuren deuten auf die Wechselbeziehungen im Produktions- und Rezeptionsprozess und zeigen, dass die Weitergabe von Büchern selbstreflexiv erfolgte: Die Schriften binden Menschen aneinander, bilden Gemeinschaften und schaffen dadurch Identitäten. Autoren oder sonstige Personen, die sich in die Handschriften einschrieben, sprechen eine lebendige Leserschaft an, indem sie durch Stimmen und Bilder direkt an die Benutzer (auch an die heutigen Wissenschaftler) appellieren und so eine Kontinuität zwischen den Produzenten und den Rezipienten andererseits konstruieren. Insofern besteht ein Charakteristikum der mittelalterlichen Handschrift in der Unmittelbarkeit der Kommunikation von Mensch zu Mensch.
Vor mehr als 500 Jahren tauschte das handgeschriebene Buch seine Einmaligkeit gegen den vervielfältigten Druck ein, und jetzt schüttelt das gedruckte Buch seine begrenzte physische Handhabung zugunsten eines unendlichen virtuellen Daseins ab. Gerade der Verlust des gebundenen Buches als sozusagen bindendes Objekt lädt zum Nachdenken über die Weitergabe von Büchern “von Hand zu Hand” und die dabei beobachtbaren komplexen Strategien ein. In der bisherigen Forschung wurde dieser Aspekt nur unzureichend berücksichtigt, und so wird das kommende Arbeitsgespräch wichtige Anstöße für weitere Untersuchungen und Diskussionen geben.
Weitere Informationen, sowie das Programm der Tagung finden Sie hier.
Kontakt:
Dr. Volker Bauer
E-Mail: forschung@hab.de